
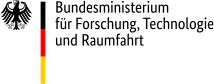
Rund 170 Teilnehmende trafen sich am 19. März in Berlin zur Konferenz „Fachkräfte für die Mikroelektronik (#skills4chips) – Wie der Innovationsstandort Deutschland durch das Zusammenspiel von Forschung und Bildung punkten kann".
Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Bildung und Forschung kommen erstmalig aus ganz Deutschland zusammen, um bei der BMBF-Konferenz #skills4chips in Berlin über mehr und besser ausgebildete Fachkräfte in der Mikroelektronik zu diskutieren.

In der Schule, im Labor, in Büros, Werkhallen und zuhause – ohne Mikrochips, Sensoren und Co. geht nichts mehr in unserer digitalen Welt. Mikroelektronik ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts und sorgt auf vielfältige Weise für Fortschritt, Wohlstand und Bildung. Möglich wurde und wird das durch Menschen, die mit naturwissenschaftlich-technischem Sachverstand in den verschiedensten Berufen und Branchen tätig sind: Als Physiklehrerin, Mechatroniker, Elektrotechnik-Professor, Nano-Technologin oder Software-Entwickler. Die Mikroelektronik braucht deutlich mehr von diesen Menschen, heute und erst recht in der Zukunft. Doch wie begeistert, gewinnt und hält Deutschland sowohl junge zukünftige Fachkräfte als auch beruflich bereits qualifizierte Menschen für diese volkswirtschaftlich so wichtigen Berufe?
Rund 170 Teilnehmende aus ganz Deutschland kamen auf Einladung des BMBF am 19. März in Berlin zusammen, um sich dieser essenziellen Frage zu widmen: Vertreterinnen und Vertreter kleiner und großer Unternehmen, der beruflichen Bildung, Führungskräfte aus Forschung, Politik und aus Verbänden. Es war das erste Treffen dieser Art und doch ein echter „Meilenstein“, wie Engelbert Beyer, Leiter der Unterabteilung „Technologieorientierte Forschung und Innovation“ des BMBF zum Auftakt betonte. Mit Blick auf das kürzlich von BMBF und BMWK veröffentlichte Positionspapier "Forschung, Fachkräfte, Fertigung: Impuls für das Mikroelektronik-Ökosystem in Deutschland und Europa" und erst recht in Vorbereitung der geplanten nationalen Mikroelektronikstrategie sei es wichtig, die nationale Diskussion um den Fachkräfteauf- und -ausbau nach vorne zu bringen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Im ersten Spotlight Talk diskutierten unter anderem Dr. Christian Koitzsch (Präsident und Geschäftsführer ESMC, Dr. Holger Becker (CSO, microfluidic ChipShop GmbH) und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Kahmen (Wissenschaftlich-Technischer Leiter und Geschäftsführer, Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik) die Frage „Welche und wie viele Talente brauchen wir, damit Deutschland in der Mikroelektronik wachsen kann?“
Es braucht Menschen mit vielen unterschiedlichen Qualifikationen. Eine Fab auf 45.000 qm zu errichten, wie ESMC derzeit in Dresden, erfordert bereits in der Bauphase andere Gewerke und Fachkräfte als etwa ein hochspezialisiertes mittelständisches Unternehmen wie Dr. Holger Becker es führt. Der Jenaer sieht es als besondere Herausforderung für KMU an, im Ringen um Auszubildende und Hochschulabsolventen mit namhaften großen Playern der Branche mitzuhalten: „Man muss sich etwas einfallen lassen!“. Berufsanfänger und -anfängerinnen schickt Becker deshalb für einige Wochen „in die Welt hinaus“, sprich zu interessanten Kooperationspartnern ins EU-Ausland. Junge potenzielle Führungskräfte umwirbt er mit früher Verantwortung und schnelleren Aufstiegschancen.
Auch Prof.-Ing. Gerhard Kahmen vom Leibnitz-Institut für innovative Mikroelektronik spürt den Wettbewerb um die besten Köpfe, sei es um die Spezialistinnen und Spezialisten im Reinraum oder diejenigen im Projekt- und Fördermittelmanagement. Die Leibniz-Gemeinschaft spricht daher bestimmte High Potentials gezielt an und fördert beispielweise junge Mitarbeitende mit Mentoring-Programmen oder Frauen, die eine Professur anstreben, mit einem Professorenprogramm. Dass Menschen aus über 30 Nationen für seine Organisation arbeiten, nennt er „ganz wichtig und eine echte Bereicherung“.

Beim zweiten Spotlight Talk „Wie kann die Fachkräftegewinnung und -ausbildung in der Mikroelektronik von einer besseren Verzahnung von Bildung und Forschung profitieren?“ kamen auch Vertreter und Vertreterinnen der hart umworbenen jungen Generation im Tandem mit ihrer jeweiligen Bildungseinrichtung zu Wort.
Ob sich Heranwachsende für technisch-naturwissenschaftliche Themen und später für entsprechende Berufe interessieren, darauf haben ihrer Erfahrung nach konkrete Vorbilder aus dem persönlichen Umfeld (Familienmitglieder, Lehrerinnen und Lehrer) entscheidenden Einfluss. Diese „Influencer“ als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für das breite Feld der beruflichen und akademischen Ausbildungsangebote zu gewinnen oder stärker einzubinden, scheint ein wichtiger Ansatzpunkt. Auch ein Schulfach „Technik“ und mehr Angebote von Unternehmen in Schulen und Hochschulen, um die Sichtbarkeit des Technologiefeldes zu erhöhen, wurden in den Gesprächen als wichtige Ansatzpunkte genannt. Weder die Elektrotechnik mit all ihren relevanten Spezialgebieten noch das weite Feld des Chipdesigns werden von der jungen Generation deutlich wahrgenommen.
Wer junge Menschen für Ausbildung und Karriere in der Mikroelektronik erreichen will, findet sie vor allem in den Sozialen Medien. Auf Kanälen wie TikTok, Instagram und Co. punktet, wessen Videos und Postings nicht nur informativ, sondern vor allem witzig und persönlich sind. In der Diskussion zeigte sich, dass Steve Federow (Silicon Saxony e.V. /GlobalFoundries) und Prof. Dr.-Ing. Jörg Schulze (Fraunhofer IISB) und Prof. Dr.-Ing. Martin Hofmann (Ruhr-Universität Bochum) gute Erfahrungen damit gemacht haben, ihre Auszubildenden und jungen Mitarbeitenden in diese Kommunikationsaufgabe verantwortlich einzubinden. Das sorge für Authentizität und Glaubwürdigkeit.

Wie dringend das Problem der Fachkräftegewinnung ist, skizzierte Dr. Anja Quednau vom Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik zum Einstieg ihrer Keynote anhand von Zahlen und Fakten: Ohne Zuwanderung würde die Zahl der erwerbsfähigen Personen (20 bis 65 Jahre) hierzulande bis 2040 (laut der Bertelsmann-Stiftung) von aktuell etwa 46,4 Millionen um 4,5 Millionen Menschen sinken, also um fast 10 %. Jeder vierte Mitarbeitende in der Halbleiterindustrie sei älter als 55 Jahre, der Frauenanteil sehr gering, Betriebe fänden kaum Auszubildende in den für die Mikroelektronik relevanten Berufen und die Nachfrage von Studienbewerbern in den einschlägigen MINT-Fächern sei weiter rückläufig, die Abbruchquote hoch. „Das ist eine sehr schwierige Ausgangslage für eine eher wachstumsorientierte Branche wie die Mikroelektronik, erst recht, wenn wir das Ziel des EU Chips Acts (20 % Marktanteil weltweit) erreichen wollen.“ Dafür bedürfe es laut Studienlage (stragegy&) eine Verdreifachung der Fachkräfte in der Halbleiterindustrie.
Diesen strukturellen Problemen gelte es etwas entgegenzusetzen. „Wir müssen besser werden. Wir müssen das bestehende System stärken. Wir müssen an der Qualität, aber auch an der Attraktivität der Berufe und der Qualifizierungen arbeiten. Aber wir müssen auch neue Initiativen starten. Wir müssen neue Zielgruppen erschließen, die wiederum andere Qualifizierungen, andere Initiativen benötigen, um überhaupt diesen enormen Mehrbedarf zu stemmen.“
Sie betonte, wie wichtig Sichtbarkeit sei. „Wir müssen es schaffen, dass die Gesellschaft, vor allem Schülerinnen und Schüler, Eltern und Berufsberaterinnen und -berater konkrete Vorstellungen von Berufen in der Mikroelektronik bekommen.“ Dazu sei es notwendig, die ganze Bildungskette von der Berufs- und Studienorientierung bis hin zur Erstausbildung, bis zum Studium zu verbessern. Ebenso bedürfe es attraktiver Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Programme für Quereinsteiger. Es gelte, die vorhandenen Potenziale zu heben, Antworten zu finden auf Fragen wie „Wie schaffen wir es, ältere Beschäftigte länger im System zu halten?“ oder „Wie schaffen wir es, mehr weibliche und mehr ausländische Fachkräfte zu gewinnen?“
Das BMBF-Leitprojekt „skills4chips“ soll das – in enger Zusammenarbeit mit anderen Initiativen – leisten. Dr. Anja Quednau ist die Projektleiterin dieser im Herbst 2024 gestarteten Initiative und stellte in ihrer Keynote Ziele und erste Erfolge vor.
In vier parallelen interaktiven Workshops debattierten jeweils ca. 30 bis 40 Teilnehmende zu ausgesuchten Themenschwerpunkten. Im Rahmen der von Mitgliedern der Fachcommunity moderierten Workshops im Fishbowl-Format konnten sich alle Anwesenden mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen, Sichtweisen und Ideen spontan am Panel beteiligen.
In den Workshops wurden diese zentralen Strategien und Maßnahmen diskutiert, um den Fachkräftebedarf zu decken und den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfähig zu gestalten:
Ein wesentlicher Punkt war die stärkere Sichtbarmachung der Mikroelektronik als Schlüsselbranche. Eine breit angelegte Informationskampagne, getragen von Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Verbänden, solle sowohl das allgemeine Bewusstsein für die Bedeutung der Mikroelektronik in der Gesellschaft schärfen als auch konkrete Berufswege aufzeigen.
Damit diese Maßnahmen möglichst viele Menschen erreichen, müssen sie mit regionalen und elektronischen Angeboten zur beruflichen Orientierung, Ausbildung und Weiterbildung verbunden werden.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der gezielten Ansprache verschiedener Zielgruppen. Neben Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und Studierenden sollen auch berufserfahrene Fachkräfte und Quereinsteigende gezielt gewonnen werden.
Ein wirkungsvolles Erzählen der Erfolge und Chancen der Branche kann dabei helfen, junge Menschen und Fachkräfte für eine Laufbahn in der Mikroelektronik zu begeistern. Um Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und Studierenden frühzeitig praktische Einblicke in die Mikroelektronik zu ermöglichen, braucht es sowohl tragfähige Konzepte für die Nutzung bestehender Reinräume als auch die Bereitstellung personeller und finanzieller Ressourcen. Für die Weiterbildung von Beschäftigten und für Quereinsteigende muss die Verfügbarkeit von flexiblen Bildungsangeboten erhöht werden. Und um Deutschland als attraktiven Arbeitsort für Fachkräfte aus dem In- und Ausland zu positionieren, braucht es zudem passende Rahmenbedingungen und unterstützende Maßnahmen. Insgesamt ist die gezielte Förderung von Ausbilderinnen und Ausbildern, Lehrkräften, Professorinnen und Professoren sowie Berufsberaterinnen und Berufsberatern der entscheidende Faktor. Denn: Diese Menschen spielen eine Schlüsselrolle bei der Fachkräftegewinnung und -qualifizierung.
Insgesamt wurde in den Workshops betont, dass eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten notwendig ist und Kooperation weiterführt als Konkurrenz. Erfolgreiche regionale Ansätze sollten überregional weitergegeben und nach Möglichkeit übernommen werden, um gemeinsam Lösungen für den Fachkräftemangel zu entwickeln.
Zusätzlich zu den inhaltlichen Diskussionen erfüllten die Workshops ein zentrales Ziel: Sie brachten die Fachgemeinschaft zusammen und gaben den vielfältigen Perspektiven der bunt gemischten Teilnehmenden Raum. Die Workshops boten die Möglichkeit, sich gegenseitig zuzuhören und gehört zu werden, wodurch ein wertvoller Austausch entstand. Gleichzeitig dienten sie als Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen, mögliche Kooperationen anzustoßen und sich gegenseitig zu inspirieren – eine wichtige Grundlage für zukünftige Zusammenarbeit.
In den Vorträgen, interaktiven Workshops und lebhaften Diskussionen wurde deutlich: Die Herausforderungen sind für alle Akteure in Zeiten des nationalen und globalen Wettbewerbs um Fachkräfte groß. Erst recht, da sich der demografische Wandel in Deutschland stärker auswirkt als in anderen Weltregionen.
Im abschließenden Plenum diskutierten Vertreterinnen und Vertreter der Bundes- und Landespolitik mit Akteuren aus der Forschung als auch der Elektro- und Digitalindustrie. Frau Dr. Catrin Hannken (zuständig für die Berufliche Bildung im BMBF) sowie Dr. Tim Schulze (BMWK) betonten, dass es wichtig sei, dass alle Beteiligten ihre Zusammenarbeit nicht nur fortsetzen, sondern weiter intensivieren. Dass die ressortübergreifende Zusammenarbeit im Themenfeld bereits gut funktioniert, zeigt das oben erwähnte Positionspapier beider Häuser.
Zudem äußerten die Podiumssprecherinnen und -sprecher die Hoffnung auf weitere Ansiedlungen von Unternehmen aus der Halbleiterbranche. Die Teilnehmenden nahmen wertvolle Impulse aus der Fachtagung für ihre jeweiligen Handlungsfelder mit und betonten die Bedeutung gezielter Initiativen, um alle relevanten Zielgruppen zu erreichen.
Die Konferenz machte erlebbar, wie viele Initiativen es bereits gibt, mit denen Bund, Länder, Kommunen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen erfolgreich und oft in Partnerschaften konkrete Angebote vor Ort für verschiedene Zielgruppen umsetzen. Elf von ihnen stellten sich beim „Markt der Möglichkeiten“ den Konferenzbesucherinnen und -besuchern mit ihren zielgruppenspezifischen Projekten vor.

Damit deren und weitere regional erfolgreiche Konzepte auch anderen Akteuren als Blaupause dienen können, gilt es nun, die Teilnehmenden und möglichst viele weitere Akteure über die Grenzen der Bundesländer, Bildungssektoren und Projekte hinweg miteinander zu vernetzen.
Zentrale Drehscheibe für weitere Aktivitäten der Community soll das im November 2024 gestartete BMBF-Leitprojekt „skills4chips“ sein. Ein zentraler Baustein von „skills4chips“ ist die Microtec Academy, die Dr. Anja Quednau in ihrer Keynote vorstellte. Als nationale Bildungsakademie konzipiert, bietet sie (Weiter)Bildungsmöglichkeiten für Menschen aller Qualifikationsstufen. Dabei bündelt die Akademie bestehende und entwickelt neue, passgenaue Qualifizierungswege entlang der gesamten Bildungskette – von der Berufs- und Studienorientierung über die duale Ausbildung, den Quereinstieg sowie die Fort- und Weiterbildung.
Apollonia Pane vom gastgebenden BMBF-Referat „Elektronik und autonomes Fahren; Supercomputing“ dankte in ihrem Schlusswort allen, die sich auf so vielfältige Weise dafür einsetzen, dass Deutschland Fachkräfte für die Mikroelektronik aus- und weiterbildet, aus anderen Ländern gewinnt und in unserem Land hält. Es sei unverzichtbar, dass alle Akteure an einem Strang ziehen. Je intensiver und kooperativer, umso erfolgreicher könne die Branche die gemeinsamen Aufgaben schultern.
Auf dass die Schlagzeile 2030 lautet:
„Deutsche und internationale Halbleiterunternehmen bauen aufgrund hervorragender Fachkräftebasis ihre Kapazitäten in Deutschland massiv aus.“
Es liegt viel Arbeit vor uns, daher: am 3./4. März 2026 sehen wir uns in Dortmund zur nächsten Fachkräftekonferenz „#skills4chips“. Sie wird von der Microtec Academy ausgerichtet. Welche weiteren Meilensteine die Mikroelektronik-Akteure in den kommenden zwölf Monaten erreicht und was sie dabei (auch voneinander) gelernt haben werden, wird Gegenstand der Konferenz sein.
Veranstaltungshinweise und Einladungen werden wieder rechtzeitig verschickt. Keine Informationen zum Thema „Elektronikforschung“ mehr verpassen? Melden Sie sich zum Newsletter an!